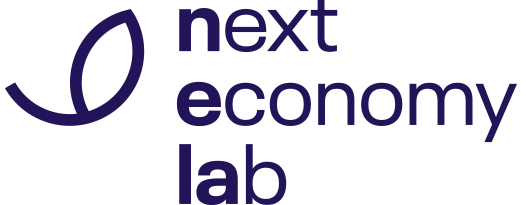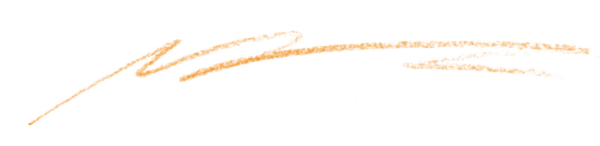Auch ohne die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas muss uns warm werden, auch im Winter, auch wenn die Sonne nicht scheint – bis spätestens 2045. Diese Dekarbonisierung stellt uns als Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Städten und Gemeinden kommt bei dieser Aufgabe eine Schlüsselrolle zu: Sie müssen den Umbau der Wärmeversorgung koordinieren, Planungssicherheit für alle Akteure schaffen.
Projekt
Wärmeplanung robust implementieren

Wärmeplanung robust implementieren
Laufzeit
09/24 - 08/27